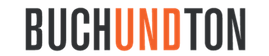Till Raether – Treue Seelen

Was war die Vorfreude auf das neue Buch von Till Raether groß. Die Lust, in das in vielerlei Hinsicht abwechslungsreichste und bedeutsamste Jahrzehnt der jüngeren deutschen Geschichte einzutauchen und sich von der Atmosphäre doch noch einmal mitnehmen zu lassen – so wie man es selbst damals erlebt hat. Das Ausreißen, das Entdecken, die scheinbare Grenzenlosigkeit und … das Unglück von Tschernobyl. Das alles kündigt der Klappentext auf der Rückseite des Buches an.
Beste Voraussetzungen also, um doch in einen zeitlosen Roman voller nostalgischer Spannung, Glückseligkeit und Veränderungen einzutauchen. Und so war die Vorfreude also ziemlich groß und der Inhalt des Romans wollte aufgesaugt werden, um selbst einmal mehr die eigenen Erfahrungen in der damaligen Zeit mit den Schilderungen von Till Raether abzugleichen und quasi erneut nachzuerleben.
Doch schon nach kurzer Zeit kam eine gewisse Ernüchterung. Nicht nur, dass die Hauptfiguren Achim und Barbara sowie Marion oft blass und irgendwie uninspiriert bleiben, auch die Handlung von „Treue Seelen“ ist recht zäh beschrieben und die Geschichte kommt lange Zeit so gar nicht richtig in Fahrt.
Achim und Barbara sind aus Bonn nach Berlin Zehlendorf umgezogen, um die neuen Möglichkeiten in der damaligen westdeutschen Großstadt mit Sonderstatus wahrzunehmen. Doch das Abenteuer Berlin stellt die Beiden mehr vor eine Probe, als dass es sie positiv beflügelt. Die Figur der Barbara ist mit ihrer Angst von radioaktiver Verseuchung wegen des kurz zuvor passierten Tschernobyl-Unfall und ihrer Lustlosigkeit auf irgendwie alles – inklusive Achim – ein schwieriger Charakter, der Achim auf gewisse Weise in die Arme seiner Nachbarin führt, die er anfangs zufällig auf dem Dachboden des Mehrfamilienwohnblocks trifft.
Marion ist älter und vor allem anders anders als Barbara und wird so zunehmend interessanter für Achim. Die beiden treffen sich regelmäßig und brechen sodann sogar zusammen nach Ostdeutschland auf, wo die Begegnung mit Marions Schwester und Achims Helfersyndrom plötzlich ungeahnte Gefahren heraufbeschwören.
Bis es dazu kommt, muss man sich als Leser allerdings recht weit im Buch vorarbeiten. Die Schreibweise ist nicht immer einfach und irgendwie hat man das Gefühl, der Autor sah sich häufig dazu angehalten, wenig Geschehnisse mit vielen Worten und leider auch immer wieder unglücklichen Satzbauten zu umschreiben. So erschließen sich manche Sätze teilweise überhaupt nicht und als Leser ist es dann schwer sich im – ohnehin lange Zeit nicht über Gebühr spannenden Szenario zurechtzufinden.
Ab der zweiten Hälfte des Buches wird es interessanter und damit auch kurzweiliger – aber bis dahin liegt eine Menge Arbeit vor dem Leser und die Befürchtung liegt nahe, dass Till Raether viele Leser auf den ersten 150 Seiten seines neuen Romans verloren haben könnte. Schade eigentlich, denn die Themen Vorwende-Zeit, Berlin und Tschernobyl bieten an sich einem Autor doch so viele Möglichkeiten.